Anbieter zum Thema
Deutsche E-Mobilität steht erst am Anfang
Die Studie bietet eine Darstellung des Ist-Zustandes der maßgeblichen OEMs und der relevanten Einflussfaktoren für die Entwicklung der Elektromobilität. Sie stützt sich auf zahlreiche aktuelle Studien zum Thema und die CAM-Innovationsdatenbank, in der die fahrzeugtechnischen Neuerungen der 19 globalen Automobilhersteller mit derzeit 60 Marken systematisch inventarisiert und durch regelmäßige Befragungen und Hintergrundgespräche mit den relevanten Branchenexperten erweitert werden.
Das eindeutige Ergebnis: In Deutschland sind das Volumen und die Wachstumsdynamik der E-Pkw und Plug-in Hybride gering. Mit rund 25.000 Neuzulassungen 2016 und einem Marktanteil von 0,75 Prozent ist das Niveau im internationalen Vergleich niedrig. Der Anteil der Elektro- und Alternativantriebe liegt lediglich bei 0,6 Prozent der Gesamtproduktion. Gleichzeitig sind derzeit die Dieselanteile an den Neuzulassungen in Deutschland und anderen EU-Ländern stark rückläufig. Führt das allerdings zu mehr Neuzulassungen bei Benzinmotoren, erhöht sich für die Hersteller der Druck zum Verkauf von Elektrofahrzeugen, um die CO2-Grenzwerte der EU für 2021 zu erreichen.
Wünsche der potenziellen E-Autokäufer
Gründe für die geringe Akzeptanz der E-Fahrzeuge sind nach wie vor die geringe Reichweite, der hohe Preis und die geringe staatliche Förderung, das vergleichsweise kleine Produktangebot, vor allem aber die mangelhafte (Schnell-)Lade-Infrastruktur. Nutzer wünschen sich dort öffentliche Ladestationen, wo sie oft parken. Für den Fernverkehr fehlt eine Grundversorgung, wobei hier das Wochenende und Ferienverkehr entscheidend sind.
„Daher fordern wir von der Bundesregierung den schnellen und konsequenten Ausbau des Ladestation-Netzes und ein normiertes Bezahlsystem für die Nutzer“, so der IVG-Vorsitzende Dr. Carsten Kuhlgatz. Denn bei ausreichender Netz- und Lade-Infrastruktur würden Kunden niedrigere Reichweiten in Kauf nehmen. Diesbezüglich gehe die chinesische Regierung konsequenter vor.
Global betrachtet
Der internationale Vergleich bringt darüber hinaus wegweisende Erkenntnisse. Die globale Produktion von Pkws und leichten Nutzfahrzeugen unter sechs Tonnen (LCV) ist seit dem Jahr 2000 von 56 Millionen auf 91,6 Millionen (2016) gestiegen. Bis 2030 prognostiziert die CAM ein weiteres Wachstum auf 116 Millionen. Weltweit betrachtet war und ist die Automobilindustrie damit eine ausgesprochene Wachstumsbranche.
Noch sind die mit Abstand wichtigsten globalen Fahrzeugmärkte China, die USA und (West-) Europa und bleiben auch maßgebend für die Strategien der globalen Automobilhersteller. Doch während mittelfristig in den USA und Europa der Markt eher stagnieren wird, birgt China bis 2030 weiteres Pkw-Wachstumspotenzial. Denn die Motorisierungsraten sind niedrig, bei erwartetem steigendem Wohlstand der Bevölkerung. Zumal die Regierung relativ strenge Vorgaben macht.
So soll es in den nächsten Jahren E-Auto-Quoten für die Erstausrüster und Verkaufsstopps für Verbrenner geben. China spielt also für die Antriebsstrategien der Zukunft eine zentrale Rolle. Wenn die Batterieentwicklung positiv verläuft und der Ladestationsausbau weiter so schnell fortschreitet wie bisher, kann der E-Auto-Bestand 2030 auf bis zu 114 Millionen Fahrzeuge anwachsen. Langfristig bietet zudem Indien erhebliches Zukunftspotenzial.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1343700/1343788/original.jpg)
Oliver-Wyman-Analyse
Deutschland droht Blackout durch E-Autos
(ID:45160521)



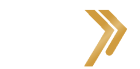
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a2/03/a2037ddcba798e63721af3f464663fbf/2026-01-06-pi-zf-ces-overall-03-chassis2-0-3840x2159v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a6/44/a644117f92295a08b388ef295839958d/0128942866v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8e/b0/8eb054e443dd9b05423ecf997b669fca/org-blobs-user-response-file-output-26861a0a-c48d-4300-8a0a-096e2f27bb30-plugin-output-call-pdnk3khywnnv0qjav60ic95m-1536x864v1.png)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c7/bb/c7bb5c06774e0f0dad04a48d06f23e01/leapmotor-br-c3-bcssel-2026-4096x2302v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/fa/c7/fac7825353c2c688ea8b6140c383e7fe/0129056044v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3c/7e/3c7e4f224ec687d1255b34695e2e4920/0129024403v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/13/ce/13ce7e80b94d05e18e5bd981f6d05efa/0129025735v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/74/a0/74a0abc49bd366ef829242551bccb28d/0129022289v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0e/5a/0e5a673eafe19401d9a65916c77e17cd/0129049539v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2e/b7/2eb7c24089328471bd06243884c46905/0129022002v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f3/ae/f3ae390af5d7a764c2ee12a57e2ed68c/0128875081v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7e/00/7e00db177b0039cfb326e5198b9fb7c5/0128895317v5.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ab/ef/abef7fb18149fbcd0d3dfc0dd3406647/0128754562v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b9/ea/b9ea5cc74ab6e72a3df51b968acb869d/spirit-ai-1585x892v1.png)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0d/96/0d962f3cbd267059820c1cd611772518/0129024669v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/26/2a/262a97b050178f0e18ec1f8eaf8bc151/fortum-20plant-20in-20artern-2c-20th-c3-bcringen-2c-20einen-20recycling-hub-20zur-20herstellung-20von-20schwarzmasse-jpg-20v-d-1920x1079v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f9/6f/f96f782540db6dd02af4279d3982fe8b/0128846362v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d5/c0/d5c03e6644e4a2d545b082b501532d1b/0128513790v2.jpeg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/2500/2547/65.jpg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/60/2a/602a60bea81b4/sag-logo-new-without-background.png)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/67/59/67596c79a1b9f/logo-shema.png)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e6/88/e6883d26ac64c200fd8fd5e3ce716e5a/0128319847v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/71/ef/71efe37ec3b008b0f3a5b20bb556ddc8/0127304512v2.jpeg)