Klimaziele CO2-Bepreisung von E-Fuels: „Totaler Irrsinn“
Das Bundesumweltministerium hofiert die Batterie-Elektromobilität und prüft einem Medienbericht zufolge, inwieweit für E-Fuels ab 2023 noch der „Emissionsfaktor null“ angewendet werden kann. So lassen sich die 2030er-Klimaziele im Verkehr nicht erreichen.
Anbieter zum Thema

Ab dem Jahr 2021 bekommen CO2-Emissionen in den Sektoren Wärme und Verkehr einen Preis. Das könnte auch klimaneutrale Kraftstoffe betreffen, schreibt das „Handelsblatt“ in seiner heutigen Ausgabe (9. September).
Lukas Köhler, klimapolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, hält die Überlegung, klimaneutrale Kraftstoffe mit einem CO2-Preis zu belegen, für absurd: „Ein CO2-Preis auf klimaneutrale E-Fuels wäre totaler Irrsinn“, sagte er dem Handelsblatt. Wenn der anteilige Ersatz fossiler Kraftstoffe durch klimafreundliche Alternativen keinen Unterschied macht, führe die Bundesregierung den Sinn und Zweck des CO2-Preises komplett ad absurdum. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) müsse aufhören, die Entwicklung von Alternativen zur E-Mobilität zu torpedieren. Andernfalls riskiere sie nicht nur das Erreichen der Klimaziele, sondern auch unzählige Arbeitsplätze in der Automobilindustrie.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1740900/1740984/original.jpg)
Kohlenstoffdioxid
CO2-Emissionen: Die falsche Bilanz
E-Fuels: Für und Wider
Hinter Köhlers Kritik verbirgt sich ein Grundsatzstreit zwischen Befürwortern und Gegnern von E-Fuels. Erstere argumentieren, die Beimischung von klimaneutralen Kraftstoffen stelle eine sinnvolle Möglichkeit dar, CO2-Reduktionen in der Bestandsflotte von etwa 48 Millionen Fahrzeugen zu erreichen. „Selbst wenn in den nächsten zehn Jahren jedes zweite neu zugelassene Auto ein Elektroauto wäre, hätten wir 2030 noch über 70 Prozent Bestandsfahrzeuge mit einem Verbrenner an Bord. Regenerative Kraftstoffe müssen insofern bei der E-Mobilität eine wichtige, ergänzende Rolle spielen.
Sie könnten bei der Beimischung zum heutigen Kraftstoff zu einer deutlichen und sofortigen CO2-Emissionsminderung in der Bestandsflotte führen. Anderenfalls würden wohl nur massive Verbote weiterhelfen, die Klimaziele zu erreichen“, erklärt Prof. Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
Wettbewerb der Technologien für Klimaschutz
Die Gegner hingegen bemängeln die Umwandlungsverluste in der Herstellung von E-Fuels. Die direkte Stromanwendung im Elektroauto sei effizienter. Doch auch hier hält Koch dagegen. „Richtig ist, dass ich mit einer Kilowattstunde Energie in einem batterieelektrischen Fahrzeug weiter fahren kann als in einem Auto mit Verbrennungsmotor und aus dieser Energie produzierten E-Fuels. Allerdings fährt auch ein Elektroauto nicht immer unter Idealbedingungen – etwa im Sommer mit Klimaanlage oder im Winter im Heizbetrieb.“ Tatsächlich liege die Differenz im Mittel über die Anwendungsfälle beim Faktor 3.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1736900/1736925/original.jpg)
CO2-Bilanzierung
E-Mobilität: „Deutschland verschenkt seine Kernkompetenzen“
In einem Zustand unbegrenzter regenerativer Energie sei dieser Nachteil langfristig allerdings nicht mehr relevant. „Entscheidend ist doch, dass wir in Deutschland heute nur rund zehn Prozent des Endenergieverbrauches aus regenerativen Energien beziehen können. Wir sind auch langfristig dringend auf den Import von E-Fuels angewiesen. Und die Energie bekommen wir nur in chemisch gebundener Form nach Europa, alles andere wäre eine Illusion“, sagt Koch. Klimaschutz im Verkehr kann nur im fairen Wettbewerb der Technologien gelingen
„Einmal gewinnt die eine, einmal die andere Technologie“
Um eine aussagefähige Gesamtbilanz von unterschiedlichen Antriebsvarianten zu erstellen, hat sich das Verfahren der Lebenszyklusanalyse in der Entwicklung etabliert, auch als LCA („Life Cycle Assessment“) bekannt. Aus wissenschaftlicher Sicht gilt es dabei, nicht nur die direkten Emissionen im Betrieb zu berücksichtigen, sondern auch jene, die durch die Produktion der Fahrzeuge, die Herstellung der Energieträger, deren Verteilung und nicht zuletzt das Recycling und/oder die Entsorgung am Ende des Fahrzeuglebens entstehen.
„Welche Antriebstechnologie besser ist, hängt stark von den unterstellten Rahmenbedingungen ab. Es gibt keinen klaren Gewinner“, fasst Dr. David Bothe von Frontier Economics zusammen. Er hat jüngst in einer Metastudie 80 Einzelstudien aus den vergangenen 15 Jahren ausgewertet. „Einmal gewinnt die eine, einmal die andere Technologie. Übereinandergelegt gibt es für alle Kombinationen von Antrieben und Energieträgern ein relativ enges Band der Gesamtemissionen“, so Bothe.
„Es ist nicht die Aufgabe der Politik, den Daumen über einzelnen Technologien zu heben oder zu senken“, appelliert FDP-Politiker Köhler im Handelsblatt. Jedes Bekenntnis von CDU und CSU zur Technologieoffenheit bleibe jedoch wertlos, wenn es von der SPD und ihrer Umweltministerin spätestens am Kabinettstisch wieder einkassiert werde.
(ID:46852992)



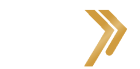
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/46/d2/46d27284e208708d0211d4b483afb49c/0128319847v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2d/94/2d94474ea5fa9e9cd7b7425e48db7aa8/0129406745v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0b/e8/0be8059c08596cb0eab0cca611310498/0129348716v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6f/06/6f0619a34fe04928393fb24ef926e98f/db2023al00588-emden-id4-vw-1795x1009v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1a/d3/1ad33a8d9e59cd9853791182a8b8b7d9/0129420687v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/83/2d/832dfc629e90c85e007e845b6048a72b/0129326048v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c6/88/c688746afcd2c9ba3a58b5b4fc50d484/0129398476v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b3/59/b35907345026fe9f0b4c14d13308b31c/0129393966v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/97/65/9765b46e41ffafb9b733a781c62aaeec/0129347916v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a2/cb/a2cb5ed7df248ec226bb4d6680e92801/0129385769v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ff/ed/ffedd7c27621d123f3c225be45bc811d/batteriewerk-20von-20acc-20in-20billy-berclau-douvrin-20dji-0564-3500x1969v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/35/58/3558ffb9840380454769925fe005adb7/0129327105v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b4/9c/b49cc962fd68d54bf1e45f115b889deb/0128808172v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8d/ea/8dea653b586d683935ff21463f072345/0129112067v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0d/96/0d962f3cbd267059820c1cd611772518/0129024669v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/26/2a/262a97b050178f0e18ec1f8eaf8bc151/fortum-20plant-20in-20artern-2c-20th-c3-bcringen-2c-20einen-20recycling-hub-20zur-20herstellung-20von-20schwarzmasse-jpg-20v-d-1920x1079v1.jpeg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/64/19/6419e8e91f1b5/wechat-image-20230316105317.jpeg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/62/e3/62e398184079a/pia-logo-rgb.png)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b2/19/b2196978594987f291b589ec97d04dcc/0111385587v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6a/77/6a774cc04dca298325995b6e95ee141f/0125442134v2.jpeg)