Produktion „Komponenten sind genauso angepasst wie das Fahrzeug selbst“
Arculus will das Fließband durch modulare Montageinseln ersetzen. Bislang erprobte das Start-up die Produktion der Zukunft vor allem mit Audi. Nun will sich das junge Unternehmen emanzipieren und dabei nicht nur Konkurrenzmarken bedienen.
Anbieter zum Thema

Fabian Rusitschka ist schwer zu erreichen. Erst beim dritten Termin kommt ein Telefonat zustande, zwischendrin wimmelt er noch Mitarbeiter ab: „Bin gerade im Interview.“ Kein Wunder. Rusitschka ist Chef des jungen Unternehmens Arculus und hat mit seinem Team bei Audi das Fließband abgeschafft – zumindest in Teilen. Im ungarischen Werk Győr montiert der Hersteller E-Motoren nach einem modularen Konzept, in Brüssel im Vormontagebereich; eine Anlage für eine Türmontage in Ingolstadt erprobt Arculus gerade in einem Projekt. „Wir haben früh das Vertrauen für Pilotprojekte bekommen“, sagt Rusitschka.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1676500/1676593/original.jpg)
Produktion
BMW-Produktionsvorstand will zwei Milliarden Euro in der Fertigung sparen
Die Vorteile einer modularen Produktion sind schnell erzählt: Dank selbstfahrender Roboter und intelligenter Software müssen Autos nicht mehr durch jeden Takt an einem Fließband. Braucht ein Fahrzeug kein Glasdach, fährt es an der Station für den Glasdacheinbau vorbei.
Die Effizienzgewinne bei den Taktausgleichszeiten sind die härteste Währung, mit denen Rusitschka nach außen geht: 20 bis 30 Prozent könnten eingespart werden, wenn Roboter Autos zu den Fertigungsstationen transportieren, statt dass selbige über ein Fließband rollen. „Und zwar überall, wo Varianten in einer Serienfertigung entstehen.“ Und er sagt: „Komplexität effizient abzubilden, geht auf zwei Wegen. Entweder man reduziert sie – oder man managt sie.“ Und da ist die Autoindustrie schließlich die mit den höchsten Herausforderungen.
Die Zulieferindustrie ist genauso interessant wie die OEMs selbst
Arculus will Lieferanten als Kunden gewinnen
Bei einzelnen Projekten soll es nicht bleiben. Die Londoner Risikokapitalfirma Atomico hat dem jungen Unternehmen aus Ingolstadt eine kräftige Finanzspritze verpasst – wie viel, will Rusitschka nicht verraten. Doch mit dem Geld will sich das Unternehmen vom VW-Kosmos emanzipieren und künftig auch nicht nur mit anderen Autobauern zusammenarbeiten. „Die Zulieferindustrie ist genauso interessant wie die OEMs selbst“, sagt der Start-up-Chef. Denn die Lieferanten müssen ebenso zahlreiche Varianten abbilden können, gerade wenn sie unterschiedliche Kunden beliefern. „Komponenten sind genauso angepasst wie das Fahrzeug selbst“, so Rusitschka. Und dann findet er noch spannend, wenn Industrien im Reinraum produzieren müssen – wie bei der Fertigung von Batteriezellen, wo keine Kontamination stattfinden darf.
Geht es um Batteriezellenherstellern, denkt man trotz der ersten Vorstöße in Europa zuallererst an Asien. Also ein Versuch, auch global Fuß zu fassen? Nein, sagt Rusitschka, sein Fokus liege in Europa: „Wir wollen, dass unsere ansässige Industrie die Produktivität steigern und die Produktion hier halten kann. Das motiviert mich.“
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1656900/1656927/original.jpg)
Produktion
Studie: Autobau in Deutschland auf niedrigstem Stand seit 22 Jahren
Flexible Fertigung bringt vor allem bei Absatzschwankungen Vorteile
Nun ist die Komplexität zweifellos stark gestiegen. Doch die Hersteller haben sich im Zuge der Absatzflaute Schlankheitskuren auferlegt und wollen dafür auch den Rotstift bei den Varianten ansetzen. „Sollte die Komplexität in der Autobranche komplett verschwinden, wäre die Fließbandfertigung natürlich die wirtschaftlichere Alternative“, sagt Rusitschka, aber die Kunden hätten sich an einen gewissen Grad an Individualisierung gewöhnt. Und dann sei die flexible Fertigung vor allem bei Absatzschwankungen von Vorteil – wie im letzten Jahr, als die chinesische Konjunkturschwäche dem Weltmarkt mehrere Millionen Fahrzeuge gekostet hat.

Daniel Küpper ist Produktionsexperte bei der Beratung BCG. Er sagt: „Wenn die Produktionsvolumen pro Variante gegen den aktuellen Trend steigen, wird die Linie wieder an Bedeutung gewinnen. Allerdings sehen wir vor allem durch die Elektrifizierung des Antriebsstrangs eher eine zusätzliche Komplexität, die in der Fertigung berücksichtigt werden muss.“ Ein reines „Zellenkonzept“ sei jedoch nicht das Optimum, sondern ein hybride Form: Eine Mischung aus einer festen Linien mit flexiblen Zellen an ausgewählten Arbeitsstationen.
Wenn Rusitschka vom Produktionssystem als Produkt spricht, meint er Roboter und Software. Man könne die Produktion in einer leeren Halle aufsetzen, quasi alles machen, doch auch kleinteiliger liefern. Denn es gebe eine „klare Entkoppelung“ zwischen Software und Robotern. Heißt: Wenn der Kunde eine eigene Flotte von fahrerlosen Assistenzsystemen hat, kann auch nur die Arculus-Software zum Einsatz kommen. „Wir leben in einem Produktgedanken, nicht im Projekt“, sagt Rusitschka. Deshalb habe man die Technik standardisiert gebaut, um unterschiedliche Anwendungen abdecken zu können.
Arculus plant mehrere Projekte parallel
Aktuell gibt es 40 Mitarbeiter bei Arculus, hauptsächlich Entwickler. Die letzten dreieinhalb Jahre trieb das Team vor allem die Software voran. Außerdem mussten sich die fahrerlosen Transportsysteme in der Fabrik beweisen. Nun will sich Arculus verstärken, um mehrere Projekte parallel abarbeiten zu können. „Wir werden in den nächsten 24 Monaten deutlich über 100 Personen sein“, sagt Rusitschka. „Das Interesse, auch aus anderen Industrien, ist groß.“ Nun sind die Abläufe in den Produktionen auch ein bisschen der heilige Gral der Autobranche. Befürchtet ein Kunde wie Audi nicht, dass Wissen abfließen könnte? Vertrauen sei unheimlich wichtig, Informationen eines Projekt blieben in selbigen. Jedoch könnten auch branchenübergreifende Lerneffekte entstehen, so Rusitschka.
„Europa kann profitieren, wenn eine möglichst flexible Fertigung genutzt wird“, sagt auch Daniel Küpper. Heute sei schwer absehbar, wie schnell sich aktuelle Trends in der Autoindustrie, wie die Volumenentwicklung bei Elektroautos, auswirken. Die modulare Produktion könne helfen, Investments zu reduzieren. „Und sie hilft europäischen Herstellern, mit den hohen Lohnkosten besser zurechtzukommen“, sagt Küpper.
(ID:46340485)



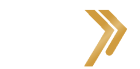
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ab/35/ab35acf92644b9b78955f87e56ae55d2/0129271089v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6a/82/6a82bb0f6bbe632e99c6fa65b133016d/0129259253v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/cb/32/cb32006aea69daad4a1c8c1e5082e955/0127861992v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6f/06/6f0619a34fe04928393fb24ef926e98f/db2023al00588-emden-id4-vw-1795x1009v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/11/56/115676a2e88397628a5c29f1d7105111/0129258926v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7c/76/7c765be05906298dd7dd4d25d39ecac4/0114966184v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/44/c8/44c85bd820b06c8535b96994dab08cc4/0129264331v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/77/95/779565e9517b993145bbf5d2c58248f1/0129249515v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/07/6c/076c0f4e7ee369493a957cf5bf09598d/adas-20bei-20nio-1280x720v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6b/1e/6b1eb7749c6edfc80effc05233fa8ce5/0129217732v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/53/d3/53d33717dbd227d49f0ef202a4c1b228/0129205356v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3d/94/3d945ec02e857ebf1770d2d64975bb62/0129236546v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/66/8c/668c04f27c1ae28679333e84558d3a5a/0129236599v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3a/98/3a98774087b0ce008e7f15807a1b2146/0129223685v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b4/9c/b49cc962fd68d54bf1e45f115b889deb/0128808172v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8d/ea/8dea653b586d683935ff21463f072345/0129112067v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0d/96/0d962f3cbd267059820c1cd611772518/0129024669v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/26/2a/262a97b050178f0e18ec1f8eaf8bc151/fortum-20plant-20in-20artern-2c-20th-c3-bcringen-2c-20einen-20recycling-hub-20zur-20herstellung-20von-20schwarzmasse-jpg-20v-d-1920x1079v1.jpeg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/68/a4/68a47beec75ce/logo-cmyk-de.jpeg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/5f/29/5f2915584e79c/invenio-logo-rz-ohne-sub.png)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/5f/84/5f84195f2387e/logo-wt.jpg)
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1678700/1678746/original.jpg)
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1678700/1678747/original.jpg)
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1678700/1678748/original.jpg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/81/fc/81fcc9c3d6017dd745c9e883b7a8fb24/0126850619v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e2/7f/e27f9ecf29a2c4c031ecae57913548ae/0128104707v1.jpeg)