Elektromobilität Volkswagen: „Wir investieren in bezahlbaren Leichtbau statt in teure Batteriezellen“
Leichtbau bringt bei E-Fahrzeugen keine nennenswerte Vorteile. „Stimmt nicht!“, sagt VW-Manager Ludger Lührmann – und beschreibt, wie Volkswagen bezahlbaren Leichtbau den teuren Batteriezellen vorzieht.
Anbieter zum Thema

Herr Lührmann, die Aussage „Leichtbau bringt bei Elektrofahrzeugen keine nennenswerten Vorteile“ hält sich hartnäckig. Sie hingegen sprechen von einer Renaissance des Leichtbaus in elektrifizierten Fahrzeugarchitekturen. Wie lauten Ihre Argumente?
Erstens: Leichtbau beeinflusst natürlich auch bei Elektrofahrzeugen positiv die Reichweite und Beschleunigung. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Gewichtsersparnis und dadurch zusätzlich zur Verfügung stehender Reichweite. Zweitens: Aufgrund der Batteriesysteme sind E-Autos mit relevanter Reichweite per se signifikant schwerer als vergleichbare Fahrzeuge ohne Hochvoltbatterie. Dadurch wird auch in anderen Bauteilen eine Gewichtsspirale in Gang gesetzt und man stößt in der Industrialisierung aufgrund von Limitierungen innerhalb der Produktionsanlagen an Grenzen. Bei der Entwicklung der ID-Familie haben wir daher ganz besonderen Wert auf Leichtbau in allen Fahrzeugteilen gelegt und somit die Gewichtsspirale stoppen können.
Was muss passieren, damit das alle Entwickler begreifen? Ich höre immer wieder, schwerere E-Autos gewinnen beim Bremsen mehr Energie zurück, weshalb der Leichtbau vernachlässigbar sei.
Auf den ersten Blick mag es stimmen, dass die Rekuperation ein Stück weit den Gewichtsnachteil kompensiert. Aber eben nicht in Gänze und auch stark abhängig vom Fahrprofil. Insgesamt braucht es einen ganzheitlichen Blick, angefangen bei der Entwicklung bis hin zur Produktion der Fahrzeuge.
Mit welchen Maßnahmen wollen Sie das Mehrgewicht neuer E-Fahrzeuge senken?
Unser größter Hebel liegt darin, dass wir bei Volkswagen bereits in der Fahrzeugkonzeption das sich ergebende zulässige Gesamtgewicht vor Augen haben und begrenzen. Das gelingt durch sorgfältige Dimensionierung der Fahrzeuge und eine geschickte Abstimmung der wesentlichen Gewichtstreiber im Entwicklungsprozess. So drehen wir die Gewichtsspirale in Form von Sekundäreffekten sogar weiter nach unten.
Des Weiteren betreiben wir „konstruktiven Leichtbau“: So verwenden wir heute in der Bauteilauslegung bereits KI-Methoden. Das heißt, die Optimierungsstrategien, etwa hinsichtlich Materialeinsatz, werden mit künstlicher Intelligenz angepasst. Ferner prüfen wir ganz konkret den Einsatz neuer Leichtbauwerkstoffe, um sie schnell in Serie zu bringen. Immer unter dem Aspekt, das Beste für den Kunden herauszuholen.
Was heißt das konkret, bezogen auf den MEB, der neuen VW-Elektromobilitätsplattform?
Der Modulare E-Antriebsbaukasten enthält eine ganze Reihe innovativer Leichtbaumaßnahmen, zum Beispiel einen Aluminium-Schweller, einen ultrahochfesten Sitzquerträger, dünne hochfeste Türaußenbleche, eine Kunststoffheckklappe und ein Batteriegehäuse aus Aluminium. Alle gemeinsam bilden die Grundlage für 420 Kilometer Reichweite mit der 58-kWh-Batterie beziehungsweise 550 Kilometer Reichweite mit der 77-kWh-Batterie – das bietet kein anderes Elektrofahrzeug im A-Segment.
Insgesamt haben wir beim MEB sehr viel in Leichtbau investiert. Allerdings nicht in der herkömmlichen Art und Weise mit Aluminium-Seitenwänden oder -Türen, sondern in Form von Aluminium-Strangpressprofilen. Bezogen auf Karosserie und Batteriegehäuse hat der MEB einen signifikant höheren Aluminiumeinsatz als Wettbewerbsfahrzeuge.
Warum war bei der Premiere des ID 3 davon nichts zu hören? Hat der Leichtbau im Vergleich zu Megatrends wie Digitalisierung, Connectivity und autonomes Fahren ein Marketingproblem?
Die ID-Familie bietet eine Vielzahl an neuen Technologien und wir haben bewusst früh angefangen, darüber zu informieren. Unsere Leichtbaumaßnahmen sind jedoch kein Selbstzweck, sondern haben in erster Linie das Ziel, die größtmögliche Reichweite für alle ID-Fahrzeuge zu erreichen. Denn für den Kunden ist es sehr wichtig, wie weit er mit seinem E-Auto fahren kann, bevor er wieder aufladen muss. Und dafür spielt der Leichtbau im Hintergrund eine „tragende“ Rolle.
Wir müssen die positiven Eigenschaften des Leichtbaus den Kunden gegenüber immer wieder aufzeigen.
Was verstehen Sie unter „produktionsfreundliche“ Leichtbautechnologien? Können Sie ein Beispiel nennen?
Leichtbau ist nur dann sinnvoll, wenn sich die Bauteile und Konzepte weltweit in allen Fabriken umsetzen lassen. Die Fertigung einer Vollaluminium-Karosserie zum Beispiel können Sie sich als OEM nur an wenigen Standorten leisten. Weil wir aber an all unseren Standorten in der Welt E-Fahrzeuge mit Reichweite brauchen, müssen wir uns alternative Konzepte überlegen. Zum Beispiel den verstärkten Einsatz von dichtereduzierten Materialien für Unterbodenschutz und Dämpfungen oder Leichtbaumodule, die wir „Plug & Play“ in unsere Werke einbringen können. Hierzu gehören Batteriegehäuse, die passgenau an die Anzahl der Zellmodule für die angebotenen Batteriekapazitäten dimensioniert sind, Crashrohre aus Faserverbundwerkstoffen und das entsprechend der Fahrzeugklasse angepasste Alu-Profil im Schweller. Der Leichtbau kostet dann zwar immer noch Geld, aber Sie haben das Problem der Integration in die Fabriken gelöst. Gleichzeitig unterstützen einige dieser Konzepte sogar das Ziel, die Produktion effizienter zu machen.
Welchen Beitrag kann der Leichtbau zum Klimaschutz und zur Ressourcenschonung leisten?
Unsere Leichtbaumaßnahmen zielen darauf ab, E-Fahrzeuge mit mehr Reichweite zu versehen und sie gleichzeitig für Millionen von Autofahrern erschwinglich zu machen. Oder anders herum: Statt die Reichweite von E-Autos mit mehr Batteriezellen teuer zu erkaufen, investieren wir in bezahlbaren Leichtbau und schonen damit Ressourcen. Das ist unser Beitrag zum Klimaschutz.
Das Bundeswirtschaftsministerium bezeichnet den Leichtbau als Schlüsseltechnologie, die maßgeblich zur Wettbewerbsfähigkeit des hiesigen Industriestandorts beiträgt. Was muss passieren, damit Deutschland hier seine Führungsrolle behält?
Als Ingenieure müssen wir in unseren Unternehmen die positiven Eigenschaften des Leichtbaus den Kunden gegenüber immer wieder aufzeigen. Etwa anhand der Sekundäreffekte, mit denen sich die Gewichtsspirale noch weiter nach unten drehen lässt. Oder der Beitrag des intelligenten Leichtbaus zur Ressourcenschonung und zum Klimaschutz – von der Herstellung bis zur Nutzung des Fahrzeugs. Dann werden wir in der Industrie, in den Hochschulen, der Politik und in den Medien viele Mitstreiter für diese Schlüsseltechnologie finden.
Das Interview führte Claus-Peter Köth.
(ID:46340285)



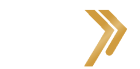
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0b/e8/0be8059c08596cb0eab0cca611310498/0129348716v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6f/06/6f0619a34fe04928393fb24ef926e98f/db2023al00588-emden-id4-vw-1795x1009v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d8/2d/d82d3a02b38db818ca74a7403a809947/52467-013-prius-2016jpg-5760x3238v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c6/5f/c65f6dbdaf6d3acaa7c80496ddc23985/239546-6000x4000-6000x3372v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/83/2d/832dfc629e90c85e007e845b6048a72b/0129326048v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/90/c1/90c1ecb946de8ca08eb0144e0529f0cc/0129348537v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/da/ab/daab4c33ba0dd5ff8985d70b39f7f7b4/0115620040v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/97/65/9765b46e41ffafb9b733a781c62aaeec/0129347916v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bd/2c/bd2c3b2b15efc3785fd9b86516860dee/agritechnica-2020251113-at136200-spfoertner-3500x1967v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/77/95/779565e9517b993145bbf5d2c58248f1/0129249515v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/07/6c/076c0f4e7ee369493a957cf5bf09598d/adas-20bei-20nio-1280x720v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ff/ed/ffedd7c27621d123f3c225be45bc811d/batteriewerk-20von-20acc-20in-20billy-berclau-douvrin-20dji-0564-3500x1969v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/35/58/3558ffb9840380454769925fe005adb7/0129327105v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/26/0e/260e5d2ccddc2ed6616f5b0d7dc8a3a1/0129295107v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b4/9c/b49cc962fd68d54bf1e45f115b889deb/0128808172v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8d/ea/8dea653b586d683935ff21463f072345/0129112067v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0d/96/0d962f3cbd267059820c1cd611772518/0129024669v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/26/2a/262a97b050178f0e18ec1f8eaf8bc151/fortum-20plant-20in-20artern-2c-20th-c3-bcringen-2c-20einen-20recycling-hub-20zur-20herstellung-20von-20schwarzmasse-jpg-20v-d-1920x1079v1.jpeg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/2500/2547/65.jpg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/118900/118944/65.png)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/60/2a/602a60bea81b4/sag-logo-new-without-background.png)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6f/7f/6f7f7c45c193c2a6dbf8704f101d3035/0124297031v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5f/42/5f426cbcab3bbdc0752a827b7cc62578/0127068689v5.jpeg)