Alterung bei ADAS Sensorfunktionen überwachen
Was, wenn Sensoren aufgrund von Alterung oder Degradation falsche Signale liefern? Unternehmen wie das Start-up Obsurver arbeiten daran, solche unsicher werdenden Funktionen zu erkennen.
Anbieter zum Thema

Kratzer auf der Windschutzscheibe, eine veränderte Einbaulage nach der Reparatur, eine verschobene Linse durch eine schrumpfende Kleberschicht, Vergilbungseffekte auf der Linse, eine Trübung auf dem Bildsensor, nachlackierte Stoßfänger. Dies sind nur einige Beispiele für mechanische oder optische Beeinträchtigungen von Kamera- oder Radarsensoren. Auch thermische Belastungen, eine beschädigte Schirmung oder Kabelisolation sowie alternde Kabelverbinder können die Ergebnisse von sensorgestützten Fahrfunktionen beeinflussen.
Eine Alterung oder Degradation von assistierenden oder automatisierten Fahrfunktionen ist aus vielerlei Gründen nie ganz auszuschließen. Die Folgen können gravierend sein: Falls zum Beispiel eine Kamera oder ein Radarsensor den Abstand eines Objekts falsch erkennt, könnten die Entfernung und daraus folgend die „Time to collision“ eventuell fehlerhaft berechnet und damit eine Notbremsung zu spät eingeleitet werden.
Voller Zugriff mit dem
Monatsabo Digital
-
Alle Inhalte werbefrei
Inklusive sämtlicher
Artikel
-
E-Paper-Archiv
Alle Ausgaben von 2015 bis heute
-
Nach dem Probezeitraum 16,90 € / Monat
Jederzeit kündbar
Sie haben bereits ein Konto? Hier einloggen
Weitere Angebote erkundenSie haben bereits ein Konto? Hier einloggen
Weitere Angebote erkunden


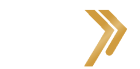
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3b/c0/3bc0bbcec401ef4e6ab5f243b6def331/adobestock-1669527454-marewa-4096x2304v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6b/1e/6b1e05efb59afc91af928af81a72f654/freevoy-batterie-copy-catl-1920x1079v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/59/79/5979e280df36f58ee00cd3b7a89bacd3/0129436676v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ed/42/ed42203f58cd9e714f0cf59b46244332/bosch-waferfab-dresden-exterieur-5-2953x1661v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/74/af/74afabc6f75811e2db9b4be118ed10cc/0128683789v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/da/85/da850de5cdff62614aa0972eb98efb88/0129482126v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/81/36/8136f31131af66984c5985a426511f72/0129473060v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/36/79/367931cb313b7d09a3dd28afa380ffde/0129465826v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/44/b1/44b15a9a977b9d6cf3504dc08b045252/0128172769v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f7/40/f74009236d312a2254ab526a5657e6b0/0129419556v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/14/b0/14b086e1b217e1ad8994b7278a251fa5/a260075-large-960x540v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a2/cb/a2cb5ed7df248ec226bb4d6680e92801/0129385769v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ff/ed/ffedd7c27621d123f3c225be45bc811d/batteriewerk-20von-20acc-20in-20billy-berclau-douvrin-20dji-0564-3500x1969v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6f/06/6f0619a34fe04928393fb24ef926e98f/db2023al00588-emden-id4-vw-1795x1009v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b4/9c/b49cc962fd68d54bf1e45f115b889deb/0128808172v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8d/ea/8dea653b586d683935ff21463f072345/0129112067v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0d/96/0d962f3cbd267059820c1cd611772518/0129024669v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/26/2a/262a97b050178f0e18ec1f8eaf8bc151/fortum-20plant-20in-20artern-2c-20th-c3-bcringen-2c-20einen-20recycling-hub-20zur-20herstellung-20von-20schwarzmasse-jpg-20v-d-1920x1079v1.jpeg)