Antriebstechnik Kommentar: Volkswagen und der Rest
VW-Chef Herbert Diess treibt mit seinem starren Fokus auf die Elektromobilität derzeit die Branche auseinander: Er findet, mit Technologieoffenheit verschwendet man nur Ressourcen – Unternehmen wie ZF oder BMW widersprechen deutlich. Ein Kommentar von »Automobil Industrie«-Chefredakteur Claus-Peter Köth.
Anbieter zum Thema

Mit seiner Fokussierung auf die Batterie-Elektromobilität spaltet VW-Chef Herbert Diess einmal mehr die Autobranche. Angetrieben von drohenden Strafzahlungen in der EU und dem Absatzmarkt Nummer 1 in China, setzt er alles auf eine Karte – zumindest vorerst. Sein Kalkül: Wenn VW mit zehn Millionen produzierten Fahrzeugen im Jahr den Hebel auf E-Mobilität umlegt, lassen sich auch die letzten Zauderer überzeugen, dass Elektro nicht mehr aufzuhalten ist, und dass es sich lohnt, richtig Geld in die Hand zu nehmen für Subventionen und für die Entwicklung neuer Technologien – inklusive Ladeinfrastruktur, Energiebereitstellung und Batteriezellproduktion. Diess will mit aller Macht seinen E-Autos, die auf den Plattformen MEB und PPE basieren, zum Erfolg verhelfen. Und das funktioniert für ihn nicht mit zu viel Technologieoffenheit.
Antrieb: Technologieoffenheit zwingend erforderlich
Für die erste Welle der E-Mobilität – mit zahlungskräftigen Kunden im urbanen Raum der entwickelten Länder – und für Fahrzeuge bis einschließlich B-Segment mag das der richtige Ansatz sein. Für die anderen jedoch wird das reine E-Auto noch Jahre tabu bleiben, weil es schlichtweg nicht das richtige Konzept für ihr Portemonnaie respektive ihren Einsatzzweck darstellt. Hier braucht es die Hybridtechnik, zunächst in der Kombination Verbrenner und batterieelektrischer Antrieb, später auch in Kombination mit der Brennstoffzelle – mindestens noch zwei Jahrzehnte lang. Vielleicht aber auch länger: Etwa dann, wenn mit Ökostrom hergestellte synthetische Kraftstoffe ab 2023 doch noch auf die Emissionsziele der OEMs angerechnet werden.
Gelänge es, diese E-Fuels in großen Mengen und zu wettbewerbsfähigen Kosten zu produzieren, würde sich das E-Auto schnell relativieren. Realistisch ist das Stand heute nicht, genauso wenig wie ein großer Sprung bei der Batterietechnik. Allein die Diskussion aber zeigt: Es gibt mehr als die eine Wahrheit, und wir brauchen zwingend eine Technologieoffenheit bezüglich „well-to-wheel“. Über die Ausprägung sollte dann jedes Unternehmen für sich frei entscheiden.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1527200/1527228/original.jpg)
Model Y
Kommentar: Bei Tesla ist was los
(ID:45815837)



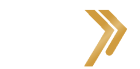
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6f/06/6f0619a34fe04928393fb24ef926e98f/db2023al00588-emden-id4-vw-1795x1009v1.jpeg)
![Bis 2040 wird der Umsatz der weltweiten Automobilzulieferindustrie auf jährlich etwa 3,0 Billionen Euro anwachsen – zwei Drittel davon werden asiatische Unternehmen erzielen. (Bild: sizsus - stock.adobe.com / [M] / KI-generiert) Bis 2040 wird der Umsatz der weltweiten Automobilzulieferindustrie auf jährlich etwa 3,0 Billionen Euro anwachsen – zwei Drittel davon werden asiatische Unternehmen erzielen. (Bild: sizsus - stock.adobe.com / [M] / KI-generiert)](https://cdn1.vogel.de/QIDKtZfBKHjZck2yYzU6BdSZEtw=/288x162/smart/filters:format(jpg):quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4b/7c/4b7ccebdf1cd07c2a4491f127b7e57ad/0129151966v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b8/6a/b86add1c5f2404173fa637ccd4a1f06f/iaa-20mobility-202025-jf-1-14619-7802x4389v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/55/39/553955ac38a9331b13898e504d835a4c/0129153436v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3e/9a/3e9af28158cc34f2ee813f4dc635326c/0129204416v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d3/2c/d32c2814f0662572d9c62237b217ce49/0129193042v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a8/10/a810d159f7ed366560d97bc7907adc13/0129189497v2.jpeg)
![Ausgewählte Titelseiten aus der 70-jährigen Historie der Fachzeitschrift »Automobil Industrie«. (Bild: mego-studio; AI [M]) Ausgewählte Titelseiten aus der 70-jährigen Historie der Fachzeitschrift »Automobil Industrie«. (Bild: mego-studio; AI [M])](https://cdn1.vogel.de/agvNktZ4ty0uqn2tctRD1c4optI=/288x162/smart/filters:format(jpg):quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/83/68/8368a7fa00e802694ca8557435bacfe9/0129169688v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/53/d3/53d33717dbd227d49f0ef202a4c1b228/0129205356v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c3/a0/c3a0686f829dce932c4d7b9cd7f36541/21176-004-3620x2036v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/28/20/282021f00c1babae88c1dc18afebf825/0129154312v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1a/3e/1a3eb0c011d92eb81aecef2966710b23/0129097398v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c6/25/c625fb0ff02f6adf92c608fa8cb8a605/-nbz1650-k-8256x4642v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8a/e7/8ae7d5ddf7780c300db7e58bc46db881/0129100305v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f3/ae/f3ae390af5d7a764c2ee12a57e2ed68c/0128875081v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8d/ea/8dea653b586d683935ff21463f072345/0129112067v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0d/96/0d962f3cbd267059820c1cd611772518/0129024669v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/26/2a/262a97b050178f0e18ec1f8eaf8bc151/fortum-20plant-20in-20artern-2c-20th-c3-bcringen-2c-20einen-20recycling-hub-20zur-20herstellung-20von-20schwarzmasse-jpg-20v-d-1920x1079v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f9/6f/f96f782540db6dd02af4279d3982fe8b/0128846362v2.jpeg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/5e/53/5e53e84a84da5/logo-aimtec.png)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/32/8e/328e3de745778f96db63363c15292bb7/93212473v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/22/69/22691a529dca810c95c7a5b1bd3ea12f/0127953631v2.jpeg)