Mobilitätskonzepte Robotaxis: „Der Vorsprung der amerikanischen Unternehmen wird schwer aufzuholen sein“
Peter Fintl, Altran, über technische Hürden beim automatisierten Fahren und die Rolle europäischer Autohersteller auf dem Robotaxi-Markt.
Anbieter zum Thema

Herr Fintl, Uber verkauft seine Einheit für automatisiertes Fahren (Advanced Techologies Group, ATG) an Aurora und beteiligt sich wiederum am kalifornischen Start-up. Klingt wie eine Win-Win-Situation.
Ja, auf jeden Fall. Uber hat mit seinem Basisangebot, dem „Betriebssystem für Mobilitätsleistungen“, ein bedeutendes Asset. Die Fahrdienste zu automatisieren ist weiterhin ein Unternehmensziel. Andererseits wächst der Druck auf Uber, endlich profitabel zu werden. Da belastete Uber ATG mit zuletzt rund 500 Millionen US-Dollar pro Jahr die Bilanz. Noch dazu ist das ein Betrag, der nicht ausreicht, den Abstand zu Waymo zu verringern. Rund 800 der 1.200 ATG-Mitarbeiter haben ein Angebot erhalten, zu Aurora zu wechseln. Einerseits kann Uber damit seine Bilanz entlasten und andererseits hat man durch die Beteiligung noch immer Zugriff auf die nötige Kompetenz für das automatisierte Fahren.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1723800/1723857/original.jpg)
Automatisiertes Fahren
Ricky Hudi: „Industrie muss nun mehr denn je ihre Kräfte bündeln“
Die neuen Mobilitätskonzepte sind in der Diskussion sehr präsent aber nicht im Alltag der Menschen, lautet das Fazit der aktuellen Mobilitätsstudie von Continental. Lohnt sich das Geschäftsmodell mit Robotaxis überhaupt?
Dass jeder darüber spricht und niemand die Dienste nutzt hat zwei Gründe. Bislang haben Nutzer Berührungsängste gegenüber Ride-Hailing. Selbst wenn noch ein Fahrer am Steuer sitzt. Das wird sich wegen Corona in nächster Zeit auch nicht ändern. Da sehe ich Städte und Kommunen in einer Enabler-Funktion, um ein breiteres Angebot an Fahrdiensten zu ermöglichen.
Andererseits war die Technik noch nicht reif. Das betrifft den gesamten Technologiestack vom Fahrzeug über die Automatisierung bis hin zur Interaktion mit den Fahrgästen. Und natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen. Da hat sich in den letzten Jahren einiges getan: Waymo, 2getthere, Zoox oder Canoo sind auf einem ganz anderen Niveau als die bekannten Shuttles, die mit 15 km/h in abgegrenzten Bereichen fahren. Die Erkenntnisse aus den Pilotprojekten lassen sich nun kommerzialisieren. Da stehen wir vor einem größeren Sprung.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1775100/1775181/original.jpg)
Mobilitätsdienste
Johann Jungwirth: „Viele unterschätzen den nächsten Technologiesprung“
Sie nennen Städte und Kommunen als Wegbereiter. Können außerhalb der Metropolen die städtischen Behörden das überhaupt leisten?
Die Städte in der Größenordnung von Hamburg oder München können das sicherlich. Dort will man den Individualverkehr reduzieren und das eigene Image aufbessern. Robotaxis im Linienverkehr bieten sich jedoch auch für dünn besiedelte Gegenden an. Damit sind die kleineren Kommunen jedoch überfordert. Hier müssten die einzelnen Bundesländer noch mehr in Form von geförderten Projekten unterstützen.
Gibt es in Europa eine führende Metropolregion für neue Mobilitätskonzepte?
Das ist momentan schwierig zu beantworten, weil die Projekte alle noch im Versuchsstadium sind. Spannend bleibt zu beobachten, wie Paris, London sowie Barcelona und Madrid den Individualverkehr verringern wollen. Vor allem die beiden letztgenannten Städte haben ein sehr gutes Innovations-Ökosystem. Da geht es nicht nur um Robotaxis sondern beispielsweise um Minimobilität mit elektrischen Zweisitzern. Ich denke, da können wir aus dem französischen und spanischen Raum sehr spannende Konzepte erwarten.
Braucht es für das Fahrdienstangebot anbieterunabhängige Cluster?
Ich denke schon, denn niemand möchte 17 Mobilitäts-Apps auf dem Smartphone haben. Da macht ein konsolidiertes Angebot mit einem einfachen Abrechnungsmodell Sinn. Außerdem wollen die Verkehrsplaner der Städte über alle Anbieter hinweg wissen, wie viele Fahrzeuge unterwegs sind, wie viele Kilometer zurückgelegt werden oder zu welchen Zeiten auf welchen Strecken das höchste Nutzeraufkommen stattfindet.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1639100/1639197/original.jpg)
Automatisiertes Fahren
Plattform SDS: Volkswagen entwickelt autonomes Fahren für alle
Wann erwarten Sie die ersten Robotaxis?
Bisher kennen wir hautptsächlich die Bilder von langsamen Shuttles, die gefühlt Minuten brauchen, um in die Gänge zu kommen. Waymo etwa hat aber mittlerweile über eine Million Kilometer automatisiert ohne Sicherheitsfahrer zurückgelegt. Die führenden Plattformanbietern auf diesem Gebiet haben zuletzt große Fortschritte erzielen können. Die Fahrzeuge bewegen sich in einer Art und Weise, die Vertrauen schafft. Ich kann mir vorstellen, dass die Technik in ein oder zwei Jahren den Weg in die Fahrzeuge der Fahrdienste findet. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es mit dem Realbetrieb in unter zwei Jahren losgeht. China ist da vielleicht ein Jahr früher dran.
Klingt, als würden zwei oder drei Plattformanbieter zunächst das Rennen machen.
Der Uber-Aurora-Deal und auch das gemeinsame Investment von Ford und VW in Argo AI zeigen schon, wie komplex und aufwändig das Thema ist. Der Vorsprung, den vor allem einige amerikanische Unternehmen haben, wird schwer aufzuholen sein. Die Aspekte Sicherheit und universelle Einsetzbarkeit kosten unglaubliche finanzielle Ressourcen. Für mich stellt sich deshalb die Frage, ob auf diesem Gebiet weitere Kooperationen nicht zielführender wären.
Fehlt den europäischen Fahrzeugherstellern der Mut hier größer einzusteigen?
Es gibt zwei Gründe, warum die europäische Industrie noch nicht so offensiv in den öffentlichen Fahrbetrieb geht. Bei der Sicherheit nimmt man es traditionell sehr genau, das ist löblich. Der zweite Punkt ist die Erwartungshaltung, die viele Menschen mit den etablierten Marken verbinden. Da sind einige Hersteller in ihrem Image gefangen. Ein unruhiger Fahrbetrieb oder eine hohe Anzahl von Phantombremsungen wäre den Kunden und den Mitfahrenden nicht zu vermitteln. Das ist vor allem bei den fahrerlosen Fahrzeugen ein wichtiger Punkt. Wenn die Insassen die Fahrmanöver nicht nachvollziehen können steigt das Gefühl der Unsicherheit. Das ist für die Entwickler der Robotaxis noch sehr herausfordernd. Aus meiner Sicht braucht es da im Fahrdienstbetrieb Menschen, die sich zuschalten können. Die dann mit den Insassen sprechen und das Fahrzeug ferngesteuert aus kniffligen Verkehrssituationen befreien. Dafür muss dann eventuell auch ein 5-G-Netz vorhanden sein.
Muss der Fahrdienstmarkt mit Robotaxis reguliert werden, ähnlich wie bei den Mobilfunklizenzen?
Das macht aus verschiedenen Gründen Sinn. Zum Beispiel, um für alle Anbieter einen fairen und gleichen Zugang zum Markt zu ermöglichen. Oder um die Dienstanbieter an den Kosten für die Infrastruktur zu beteiligen.
In einigen Städten führen günstige Ride-Hailing-Angebote zu mehr Verkehr auf den Straßen. Die Kommunen könnten über Gebühren den Fahrdienstmarkt so steuern, dass im Mix aus Individualverkehr und Fahrdiensten nicht mehr Fahrzeuge unterwegs sind als heute.
(ID:47047246)



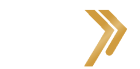
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3b/c0/3bc0bbcec401ef4e6ab5f243b6def331/adobestock-1669527454-marewa-4096x2304v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6b/1e/6b1e05efb59afc91af928af81a72f654/freevoy-batterie-copy-catl-1920x1079v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/59/79/5979e280df36f58ee00cd3b7a89bacd3/0129436676v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ed/42/ed42203f58cd9e714f0cf59b46244332/bosch-waferfab-dresden-exterieur-5-2953x1661v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/74/af/74afabc6f75811e2db9b4be118ed10cc/0128683789v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/da/85/da850de5cdff62614aa0972eb98efb88/0129482126v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/81/36/8136f31131af66984c5985a426511f72/0129473060v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/36/79/367931cb313b7d09a3dd28afa380ffde/0129465826v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/44/b1/44b15a9a977b9d6cf3504dc08b045252/0128172769v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f7/40/f74009236d312a2254ab526a5657e6b0/0129419556v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/14/b0/14b086e1b217e1ad8994b7278a251fa5/a260075-large-960x540v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a2/cb/a2cb5ed7df248ec226bb4d6680e92801/0129385769v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ff/ed/ffedd7c27621d123f3c225be45bc811d/batteriewerk-20von-20acc-20in-20billy-berclau-douvrin-20dji-0564-3500x1969v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6f/06/6f0619a34fe04928393fb24ef926e98f/db2023al00588-emden-id4-vw-1795x1009v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b4/9c/b49cc962fd68d54bf1e45f115b889deb/0128808172v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8d/ea/8dea653b586d683935ff21463f072345/0129112067v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0d/96/0d962f3cbd267059820c1cd611772518/0129024669v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/26/2a/262a97b050178f0e18ec1f8eaf8bc151/fortum-20plant-20in-20artern-2c-20th-c3-bcringen-2c-20einen-20recycling-hub-20zur-20herstellung-20von-20schwarzmasse-jpg-20v-d-1920x1079v1.jpeg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/2500/2547/65.jpg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/113400/113491/65.gif)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/62/e3/62e398184079a/pia-logo-rgb.png)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a7/ab/a7ab6f1cf9b930854b0a6ab35e95d8d5/0112248395v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/55/39/553955ac38a9331b13898e504d835a4c/0129153436v2.jpeg)