Alternative Energieträger Wasserstoff: „Wir haben keine andere Wahl, als jetzt zu investieren“
Die Bundesregierung will Deutschland bei moderner Wasserstofftechnik zum „Ausrüster der Welt“ machen. David Wenger, Geschäftsführer Wenger Engineering, beantwortet die wichtigsten Fragen zur Technologie.
Anbieter zum Thema

Nach langen Verzögerungen soll es nun schnell gehen. Die Bundesregierung will kurzfristig eine Wasserstoffstrategie vorlegen, berichtet die Nachrichtenagentur „dpa“ am Donnerstag (4. Juni). Das beschlossen die Spitzen von Union und SPD demnach. Ziel solle es sein, Deutschland bei modernster Wasserstofftechnik zum „Ausrüster der Welt“ zu machen, wie es in einem Papier heißt. Die schwarz-rote Koalition will die Entwicklung von Wasserstoffproduktionsanlagen fördern.
Um den Einsatz der Technologie auch in Deutschland im Industriemaßstab zu demonstrieren, sollen bis 2030 zunächst industrielle Produktionsanlagen von bis zu fünf Gigawatt Gesamtleistung entstehen, bis 2035 sollen weitere Kapazitäten dazukommen. Der Umstieg von fossilen Energieträgern auf Wasserstoff soll insbesondere bei industriellen Prozessen gefördert werden. Geplant sind etwa Investitionszuschüsse in neue Anlagen. Und: Die Produktion von „grünem“ Wasserstoff soll von der EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms befreit werden.
Herr Wenger, damit Wasserstoff wirklich nachhaltig ist, muss er „grün“ sein. Mit Blick auf Deutschland Stand heute: Wie erzeugen wir unsere benötigte Energie, und wie viel Prozent davon können wir bereits regenerativ umwandeln? Wie viel bleibt für industrielle Projekte übrig, zum Beispiel für Elektrolyseure?
Ich glaube, dass nur „grüner“ Wasserstoff wirklich sinnvoll ist. Alles andere ist entweder aus Klimaschutzgründen absurd, zum Beispiel Wasserstoff aus Erdgas, oder es ist nicht nachhaltig sowie nur schwer umzusetzen und zu kontrollieren. Pro Jahr werden in Deutschland rund 500 Terrawattstunden, kurz TWh, Strom erzeugt, davon ein knappes Drittel aus Kohle. Dazu kommt ein Mehrfaches dieser Energiemenge in Form von Öl und Gas, die fast zu 100 Prozent importiert werden. Wir sprechen also über riesige Mengen, und aktuell ist nichts „übrig“. Wenn wir einen Überschuss haben, verkaufen wir ihn ins Ausland und umgekehrt, im Notfall sogar zu Negativpreisen.
Klar ist aber, dass pro Jahr etwa fünf bis zehn TWh Strom vor allem aus Windkraft nicht produziert werden, weil die Netze ihn nicht aufnehmen können. Diesen Strom müssen wir produzieren und speichern, um ihn dann entweder später wieder in Strom umzuwandeln oder die gespeicherte Energie sektorübergreifend einzusetzen, zum Beispiel im Verkehr. Der Kraftwerkspark ist da und wächst weiter, diese Ausrede darf nicht gelten.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1710000/1710080/original.jpg)
Alternative Energieträger
Grüner Wasserstoff – Chance für Automobilzulieferer
Stichwort: Brennstoffzellenfahrzeuge. Volkswagen setzt voll auf batterieelektrische Autos, Daimler entwickelt keine Brennstoffzellenantriebe mehr für Pkws, dafür aber gemeinsam mit Volvo für Trucks. Hyundai und Toyota sehen die Technik in beiden Klassen. Vereinfacht gefragt: Wer hat recht und warum?
Ich traue mich nicht zu sagen, wer recht hat und wer nicht. Eine solche Aussage wäre unseriös, weil niemand die Zukunft vorhersehen kann. Es handelt sich um betriebswirtschaftlich motivierte Entscheidungen. Hyundai investiert gerade sechs Milliarden in Wasserstofftechnologie – Volkswagen und Daimler wollen oder können das nicht leisten.
Aus Standortgründen hoffe ich sehr, dass die deutschen OEMs recht haben – aber bei Hyundai und Toyota geht es nicht um die Frage „Pkw oder Lkw“ – die machen beides. Oder im Fall von Hyundai alles: Pkw, Lkw, Züge, Schiffe, Baumaschinen und stationäre Systeme. Ich halte Hyundai für die führende Firma auf dem Gebiet.
Der deutschen Politik fiel es bislang schwer, sich auf eine Wasserstoffstrategie zu einigen. Einige norddeutsche Bundesländer preschen mit einer eigenen Strategie voran. Wieso ist ein gemeinsamer Konsens so schwierig?
Salopp gesagt: Weil wir in Deutschland sind. In China ist ein solcher „Konsens“ leichter zu erzielen, weil die Regierung den Weg vorgibt. Unsere Form der Demokratie hat Vorteile, aber an diesem Punkt tun wir uns eben schwer. Viele Interessensgruppen wollen mitreden, und wir dürfen nicht vergessen: Wir haben viel zu verlieren. Wir sind als Nation Weltmarktführer für Autos und Autoteile, und bei einer kompletten Veränderung des Marktes könnte auch das sich ändern. Das hätte gravierende Auswirkungen auf unseren Wohlstand.
Unterstellen wir eine einheitliche, nationale Wasserstoffstrategie: Wie steht es um die notwendige Infrastruktur?
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1630800/1630808/original.jpg)
Automobilzulieferer
„Das batterieelektrische Fahrzeug wird nur ein Teil des künftigen Antriebsmix sein“
Die Infrastruktur sehe ich nicht als Problem. Das wird zwar immer wieder behauptet, aber ich halte das für Ausreden. H2 Mobility hat bewiesen, dass man in wenigen Jahren flächendeckend Tankstellen bauen kann. Wenn die Nachfrage da ist, kommt die Infrastruktur von alleine. Es muss ja auch nicht in allen Bereichen auf einmal losgehen. Die Versorgung von Wohnhäusern etwa halte ich für ein Problem, das man später lösen kann – oder gar nicht, weil man Heizungen auf Wärmepumpen umstellt. Für größere Industrieanwendungen oder auch Tankstellen kann man Pipelines nutzen, das ist eine bekannte und bewährte Technologie.
Was fehlt unserer Infrastruktur aktuell, um eine funktionierende Wasserstoffgesellschaft wirtschaftlich abzubilden?
Der Begriff „Wasserstoffgesellschaft“ ist schon lange bekannt und zum Beispiel in Japan auch schon weit verbreitet als Zielbild. Ob er für Deutschland auch geeignet ist, bezweifle ich. Wir neigen ja dazu, alles perfekt haben zu wollen. Wenn es noch nicht perfekt ist, fangen wir gar nicht erst an. Ich plädiere mehr dafür, einzelne, lokale Erfolgsbeispiele zu schaffen, diese zu lokalen Ökosystemen auszubauen und dann zu verknüpfen.
Der Unternehmer Reinhold Würth hat mal gesagt: „Eine Firma ist wie eine Märklin-Eisenbahn. Man fängt mit ein paar Schienen und einem Zug an. Und immer, wenn man Geld hat, kauft man sich neue Weichen, Schienen und Züge dazu, bis man irgendwann eine ganze Landschaft hat.“ So sehe ich es hier auch: Wir müssen nicht über Nacht alles umbauen. Wir können Schritt für Schritt vorgehen, aber zügig und zielgerichtet.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1670800/1670813/original.jpg)
Automobilzulieferer
„Etwa zehn Antriebsarchitekturen könnten übrig bleiben“
Muss die Industrie hier vorangehen, damit sich die Systeme nach und nach in Lkws, Bussen und Pkws durchsetzen können?
Ich halte industrielle Anwendungen für deutlich einfacher umzusetzen als den Verkehr. Hier gibt es einen Kunden – den Betreiber einer Raffinerie, einer Düngerfabrik oder Ähnliches – und einen Produzenten für Wasserstoff, der ihm heute schon Tausende Tonnen liefert. Wenn diese Produktion von Erdgas auf grünen Strom umgestellt wird, sparen wir direkt CO2 ein.
Im Fahrzeugmarkt kommen Millionen an Kunden dazu, die beim Fahrzeugkauf eine hoch emotionale Entscheidung treffen. Der Antrieb ist gegenüber dem Design oder dem Markenimage untergeordnet. Ich glaube, dass die optimale Reihenfolge die ist: Industrie, Lkws und Züge, Busse, Pkws. Aber wie gesagt: ausgehend von lokalen, sinnvollen Grundverbrauchern, nicht Demonstrationsprojekten, die mit Gießkannenförderungen ermöglicht werden.
Brauchen wir einen übergeordneten, politischen Plan, der auch umfangreiche Subventionen umfasst?
Natürlich brauchen wir einen politischen Plan. Wenn der Betreiber einer Elektrolyse Unsummen an Steuern auf jede Kilowattstunde Strom zahlen muss, kann das unmöglich zu einem Business Case werden, und verhindert das, wofür das EEG eigentlich ins Leben gerufen wurde: Die Energiewende. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf. Wenn ich jetzt sage, dass es Milliarden kosten wird, klingt das erst einmal nach viel Geld. In Relation zu anderen Infrastrukturmaßnahmen, aber vor allem auch in Relation zu den Folgekosten des Klimawandels ist es jedoch wenig. Wir haben keine andere Wahl, als dieses Geld jetzt zu investieren.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1658200/1658219/original.jpg)
Elektromobilität
Chinas neue Antriebsstrategie: „Unterm Strich hatten Daimler und BMW recht“
Sehen Sie sogenannten blauen Wasserstoff als sinnvolle Übergangslösung?
Klarer Fall: Nur grüner Wasserstoff darf unterstützt und gefördert werden. Alles andere ist verschwendete Zeit und verschwendetes Geld. Wir dürfen den Fehler nicht wiederholen, den wir früher mit Mülldeponien und auch dem Nuklearabfall gemacht haben: das Problem auf folgende Generationen zu verschieben, nur um ein paar Euro zu sparen.
Das Thema Wasserstoff an sich ist umfangreich. Haben Sie einen Tipp, wo sich unsere Leser zum Thema weiter informieren können?
Den habe ich: Am 8. Oktober 2020 – das ist der National Hydrogen Day in den USA – findet die weltweit größte Wasserstoffkonferenz statt, die „Hydrogen Online Conference“. Teilnehmen können Sie ausschließlich online, und es ist kostenlos. Bei der Konferenz sind alle relevanten Marktteilnehmer vertreten; für Einsteiger und Profis ist das gleichermaßen eine gute Gelegenheit, sich zum Thema Wasserstoff zu informieren.
Das Interview führte Thomas Günnel
(ID:46547306)



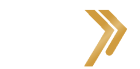
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3b/c0/3bc0bbcec401ef4e6ab5f243b6def331/adobestock-1669527454-marewa-4096x2304v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6b/1e/6b1e05efb59afc91af928af81a72f654/freevoy-batterie-copy-catl-1920x1079v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/59/79/5979e280df36f58ee00cd3b7a89bacd3/0129436676v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ed/42/ed42203f58cd9e714f0cf59b46244332/bosch-waferfab-dresden-exterieur-5-2953x1661v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/74/af/74afabc6f75811e2db9b4be118ed10cc/0128683789v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/da/85/da850de5cdff62614aa0972eb98efb88/0129482126v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/81/36/8136f31131af66984c5985a426511f72/0129473060v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/36/79/367931cb313b7d09a3dd28afa380ffde/0129465826v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/44/b1/44b15a9a977b9d6cf3504dc08b045252/0128172769v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f7/40/f74009236d312a2254ab526a5657e6b0/0129419556v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/14/b0/14b086e1b217e1ad8994b7278a251fa5/a260075-large-960x540v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a2/cb/a2cb5ed7df248ec226bb4d6680e92801/0129385769v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ff/ed/ffedd7c27621d123f3c225be45bc811d/batteriewerk-20von-20acc-20in-20billy-berclau-douvrin-20dji-0564-3500x1969v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6f/06/6f0619a34fe04928393fb24ef926e98f/db2023al00588-emden-id4-vw-1795x1009v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b4/9c/b49cc962fd68d54bf1e45f115b889deb/0128808172v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8d/ea/8dea653b586d683935ff21463f072345/0129112067v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0d/96/0d962f3cbd267059820c1cd611772518/0129024669v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/26/2a/262a97b050178f0e18ec1f8eaf8bc151/fortum-20plant-20in-20artern-2c-20th-c3-bcringen-2c-20einen-20recycling-hub-20zur-20herstellung-20von-20schwarzmasse-jpg-20v-d-1920x1079v1.jpeg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/5f/29/5f2915584e79c/invenio-logo-rz-ohne-sub.png)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/35900/35916/65.jpg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/60/2a/602a60bea81b4/sag-logo-new-without-background.png)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6a/77/6a774cc04dca298325995b6e95ee141f/0125442134v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b8/83/b8835f59b90dffb9af05e349ae18f8e4/0124347490v2.jpeg)