Zulieferer Leonis hoffnungsvoller Blick in die Zukunft
Der Automobilzuliefer Leoni geht durch schwere Zeiten: Trotz hoher Auftragsvolumen bleibt die Marge schwach. Der Grund sind hohe Kosten durch Produktionsprobleme und Managementfehler.
Anbieter zum Thema

Bis zum Jahr 2015 lief es für den Zulieferer Leoni – abgesehen von der allgemeinen Wirtschaftskrise 2008/2009 – sehr gut. Doch seit nun fast vier Jahren schwimmt das Unternehmen in unruhigen Gewässern, aus denen es nicht mehr herauszufinden scheint. Auf seiner letzten Bilanzpressekonferenz im Jahr 2015 vermeldete der damalige CEO Klaus Probst einen Rekordumsatz. Doch damals kündigten sich bereits die Probleme an, die Leoni bis heute belasten. Unerwartete Anlaufkosten und Performance-Probleme in den Werken drückten auf die Marge.
Leonis Odyssee brachte Geschichten hervor, die man eher in einem Wirtschaftskrimi erwarten würde: 2015 ist den Nürnbergern durch massive Produktionsprobleme der Standort in Rumänien „um die Ohren geflogen“ zitiert das Manager Magazin den damaligen Chef Dieter Bellé. 2016 haben Betrüger den Zulieferer um 40 Millionen Euro geprellt. 2017 soll Leoni verpasst haben, seine Zahlungen für Software-Lizenzen an die stark gestiegenen PC-Arbeitsplätze anzupassen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb damals von Mehrkosten über 20 Millionen Euro. Unter anderem diese Probleme zwangen letztlich Bellé zu einer vorzeitigen Aufgabe seines Amtes als CEO.
Aldo Kamper: Leonis neue Hoffnung
Seit September 2018 sitzt nun Aldo Kamper im Chefsessel. Doch die Mitarbeiter, die auf Kontinuität in der Unternehmensführung hofften, wurden abermals enttäuscht. Wieder sind es unerwartete Anlaufkosten in einem neuen Werk. „Wir haben große Schwierigkeiten bei der tiefergehenden Planung der Abläufe in einigen Fabriken“, zitiert die Süddeutsche Zeitung einen Insider. Diesmal musste Finanzvorstand Karl Gadesmann gehen, ihm sollen 2.000 Mitarbeiter folgen – Leoni muss sparen.

Anfang April gab Leoni nun einen Ausblick auf das Bordnetzgeschäft und die Marktpotenziale. Udo Hornfeck, Chief Technology Officer des Bordnetzbereichs, zeigte den Einfluss aktuellen Trends auf das Geschäft des Zulieferers. Laut Hornfeck benötigen E-Autos und automatisierte Fahrzeuge deutlich mehr Kabel und Leitungen im Bordnetz. Gegenüber dem Verbrenner falle lediglich der (Verbrennungs-)Motorkabelsatz weg.
Hinzu kommen allerdings eine Vielzahl an Leitungen für den E-Antrieb, die Batterie und die Ladetechnik. Gegenüber den Fahrzeugen mit Verbrennungstechnik entstünden über die Segmente B, C und D dadurch Mehrkosten zwischen 15 Prozent (48-V-Mild-Hybrid) und 130 Prozent (batterieelektrisches Auto).
Wachsendes Bordnetz durch E-Mobilität
Positiv für Leoni sind zudem zusätzliche Bedarfe, die durch neue Funktionen entstehen. So müssen zum Beispiel für die Fahrerassistenzsysteme viele Sensoren verkabelt werden oder es entstehen neue Schnittstellen für die Funktion der Over-the-air-updates. Für das Jahr 2030 erwartet Leoni bei den neu produzierten Fahrzeugen einen Anteil der batterieelektrischen Autos (BEVs) von 15 Prozent und bei den Vollhybriden von 19 Prozent. Allerdings schätzt man den Markt für automatisierte Fahrzeuge eher zurückhaltend ein: Lediglich acht Prozent der Neufahrzeuge sollen Funktionen nach SAE-Level 3 haben. Die Level 4 und 5 werden nur zu vier bzw. zwei Prozent abgedeckt.
„Es ist beabsichtigt, die Fahrzeuge bereits auf die vollen Level-3-Fähigkeiten oder höher vorzubereiten“, schätzt Hornfeck den Markt ein. Denn dadurch ist es möglich, „die Fahrzeuge später per Software-Update zu aktualisieren“, so der Leoni-CTO.
OEMs fordern Einsparpotenziale
Wer sich momentan unter Zulieferern umhört, erfährt, dass einige OEMs Druck aufbauen und massive Kostensenkungen einfordern. Es ist nicht zu erwarten, dass die Autohersteller bei E-Autos Kostensteigerungen akzeptieren. Im Gegenteil: Bleibt die Batterietechnik ein dominierender Kostenblock, muss bei den anderen Komponenten stärker gespart werden als heute schon bei den reinen Verbrennern.
Einsparpotenziale sieht Hornfeck bei den Hochvoltleitungen (HV) im E-Antriebsstrang. Die Leitungssätze für die Ladetechnik könnten optimiert werden. Weiter lassen sich HV-Nebenleitungssätze und die Verkabelung des Antriebs mit kürzeren und ungeschirmten Leitungen umsetzen. Hornfeck erwartet zudem, dass das Dreiphasenkabel entfallen kann, wenn die Steuerelektronik in die E-Motoren integriert wird. „In Summe wird es einen signifikanten Preisrückgang im Bereich von 100 bis 140 Euro pro Auto geben“, ist sich der Manager sicher.
Neue E/E-Architektur soll Bordnetz vereinfachen
Das größte Potenzial sieht Hornfeck jedoch in neuen E/E-Architekturen für künftige Fahrzeuge. Die Reduktion von Steuergeräten, durch Zonen-Controller ersetzte Domänen-Controller, der zunehmende Einsatz von Lichtwellenleiter und weniger Schalter im Interieur durch zentralisierte Bedienerschnittstellen sind hierbei die wichtigsten Trends. In diesem Bereich arbeite Leoni bei der Entwicklung neuer Konzepte mit einigen OEMs zusammen. Die Markteinführung solcher neuer Architekturen ist für die Zeit zwischen 2024 und 2030 geplant.
Für ein Bordnetz von Leoni erwartet Hornfeck bis 2030, über das Auftragsvolumen gewichtet, konstante Kosten für die OEMs. Sinkende Preise bei den Leitungssätzen sollen also durch eine zunehmende Verschiebung zu E-Autos – und deren höheren Bedarf an Leitungssätzen – kompensiert werden. Doch dafür muss Leoni seine Produktionsabläufe in Griff bekommen.
Leoni strebt höhere Automatisierung in Produktion an
Noch immer ist der Anteil von manuellen Tätigkeiten sehr hoch. Hornfeck sieht jedoch Potenzial zur Automatisierung durch die neuen Konzepte. „Hochvoltleitungen sind bereits heute weniger komplex als Niedervoltleitungen. Da ist jetzt schon Potenzial zur Automatisierung gegeben.“ Das sei in der Vergangenheit noch nicht umgesetzt worden, weil man die für eine Automatisierung nötigen Volumen erst jetzt im Markt sehe.
Bei den Niedervoltleitungen sieht Hornfeck die Möglichkeit, dass die bisher monolithisch aufgebauten Kabelsätze bei den nächsten Plattformen in einzelne Module zerlegt werden. „Damit ergeben sich Möglichkeiten, diese kleineren Module stärker automatisiert zu fertigen – bis hin zur Endmontage“, sagt Hornfeck. Um das auch umsetzen zu können geht Leoni unter anderem eine Kooperation mit Relayr ein.
Leoni-CEO Kamper will das Tempo herausnehmen
Es bleibt abzuwarten, ob Leoni wirklich die anscheinend vorhanden Mängel in der Werks- und Produktionsplanung überwinden kann. Aldo Kamper sieht einen Hauptgrund für die Misere im zu schnellen Wachstum der vergangenen Jahre. Er wolle das Tempo herausnehmen, verkündete er auf der Bilanzpressekonferenz im März 2019. Auf dem Weg in ruhigere Gewässer wird Kamper noch einige stürmische Tage durchleben, denn es sind noch nicht alle angenommenen Aufträge in ein Serienprojekt umgesetzt.
Aktuell bereite man noch sechs Standorte auf neue Serienanläufe vor. Zudem werden zwei Standorte verlagert bzw. zusammengelegt. Um in der Analogie zu bleiben: Wie man hört hoffen die Leoni-Mitarbeiter weiterhin, dass ihr Kapitän an Bord bleibt. Kontinuität wäre jetzt das stärkste Signal für sie und die Geschäftspartner.
(ID:45858559)



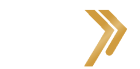
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ef/fa/effa56c92caa987f8b90150e8121b607/l9-outdoor01-11358x6389v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/24/7f/247fac09b6703e8c5a3f21e5ab275b51/0129727992-541x304v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7b/76/7b76ffba91fc74d3c36bb922f5627e3c/0129333748v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a9/e9/a9e9dd20ad9f5a0a9f2b861e04024e89/0129703084v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/88/95/8895631c77840b56b6bea6eca8101693/0103311273v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2e/59/2e59d77d0a8891a20da20ad7951afc99/0129767051v7.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b5/ef/b5ef62c320652deab483f9e298490540/0129744210v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/54/62/54625f444d6a66187f0ce30cc7555664/0129783860v5.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/99/c3/99c32fc0ddadf07eaea9e5747ad8c81f/0129467191v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0b/bc/0bbcb1b610cf74d94922a9d89a037e88/0129755383v4.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c8/b1/c8b10c2d4f68cab67b379e34b74b9465/0129750872v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ca/05/ca05bbfe2377b7146f00bd58996e49f6/0129623941v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a4/bd/a4bdc46345bf8adae6dd1125d89f7ae9/0129527193v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/14/b0/14b086e1b217e1ad8994b7278a251fa5/a260075-large-960x540v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/92/db/92dbbfff5da437a3fd0e20fa8b1b8fc1/0129739814v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/15/69/15690493bb3a26e5b7b711ad639e6745/0129693562v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b3/40/b340ddcfc465d6ada14555a3cf53fcc5/0129575575v2.jpeg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/5e/53/5e53e84a84da5/logo-aimtec.png)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/67/59/67596c79a1b9f/logo-shema.png)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/52/4c/524c2bd860fd07c8cd5de6152f5fdbc3/0126433807v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f9/f6/f9f6a0fd18300a8e369e656023954ef1/0124434640v1.jpeg)